
Jan. 18, 2023 | Ich sach ja nur, Mein Senf, Uncategorized
Freundschaften sind nicht immer leicht, vor allem, wenn uns die Welt das ein oder andere Bein stellt. Und das tut es ja schon seit einigen Jahren. Gesundheitslage, Klimakrise und Kriege können nicht spurlos an uns vorbeigehen. Wir sind auf Wachstum und Verbesserung geeicht und kommen nicht gut damit klar, wenn wir uns zurückentwickeln Richtung Neandertal. Wer sich erschöpft fühlt, vom Leben und vom so genannten Miteinander, grenzt sich gerne ab.
Während eines Streits sagte eine Freundin zur anderen, sie sei nicht dafür verantwortlich, dass es der anderen gut gehe. Das kann man drehen und wenden und entweder zu dem Schluss kommen, dass man sich für das Wohlergehen von nahestehenden Menschen verantwortlich fühlt. Oder aber, dass jeder seines Glückes Schmied ist und wir ihn im Leben nur begleiten. Nun ist es ja durchaus ein legitimer Ansatz, keine Verantwortung für das Glück anderer übernehmen zu wollen, man hat ja genug damit zu tun, dem eigenen nachzujagen.
Es gibt jedoch eine Verantwortung, der kann ich mich nicht entziehen. Sie entsteht, wenn es einem Menschen aufgrund meiner Handlungen und Worte (oder dem Ausbleiben derselben) schlecht geht. Es ist keine Verantwortung, die ich freiwillig übernehme, sondern eine, die mir zufällt, wenn ich jemanden verletze. Sei es bewusst oder unbewusst, vorsätzlich oder unbedacht und egal, ob ich die Reaktion des anderen verstehen kann oder nicht. Das heißt nicht, dass ich alles zurücknehmen und das Gegenteil behaupten oder gegen meine inneren Überzeugungen agieren muss.
Aber wenn ich eine Möglichkeit sehe, es für den anderen leichter zu machen, dann sollte ich das tun.
Die Nachbarin – nachdenklich
.

Jan. 17, 2023 | Ich sach ja nur, Mein Senf, Uncategorized
Immer wieder stolpere ich in den sozialen Medien über „Nein ist ein ganzer Satz“. Darunter tausendfache, jubelnde Zustimmung. Ich habe dabei Bauchweh. Klar gibt es Situationen, in denen ein „Nein“ Aussage genug ist. Zum Beispiel, wenn die körperliche Unversehrtheit, Leib und Leben in Gefahr sind. Im alltäglichen Umgang jedoch, sage ich zu dieser Aussage „nein“. Würde jetzt nichts mehr kommen, würde dieser Beitrag keinen Sinn machen, denn so funktioniert Kommunikation einfach nicht. Die gleichen Menschen, die in den Kommentarspalten klatschen, bejammern an anderer Stelle die Verrohung der Gesellschaft und dass es überall an Empathie, Menschlichkeit und Mitgefühl mangelt.
„Nein ist ein ganzer Satz“ meint: Sieh mich! Wahre meine Grenzen! Beute mich nicht aus! Und bezieht sich in der Regel auf unfaire Chefs, hinterhältige Kollegen, zu viel Arbeit. Auf aufdringliche Nachbarn, distanzlose Freunde und dreiste Fremde. Auf zu viele Elternabende, eine Politik, die uns nicht abholt, dominante Eltern, aufsässigen Nachwuchs und sperrige Partner. Er sagt, bis hierhin und nicht weiter.
„Nein!“ – mit Ausrufezeichen, heißt, wir müssen es vehement sagen, um gehört zu werden und uns gleich noch mit zu überzeugen. Denn viel zu oft lassen wir es zu weit kommen. So weit, dass wir nicht mehr können. Immer wenn wir „ja“ sagen, obwohl wir „nein“ meinen, weil es uns eigentlich zu viel wird. Wenn ich zustimme – aus Höflichkeit, aus Pflichtgefühl, aus der Verantwortung heraus – oder weil es zu anstrengend ist, „nein“ zu sagen. Weil eh schon alles so anstrengend ist und ich lieber den Weg des geringeren Widerstands gehe und dann am Abend netflixe, um runterzukommen.
Alle, die „Nein ist ein ganzer Satz“ liken, denken dabei an bestimmte Situationen und einen bestimmten Menschen. Und vielleicht feiert dieser die Aussage gerade genauso, weil er sich an der gleichen oder aber einer anderen Stelle genauso fühlt. Klein und ausgelaugt, übervorteilt und ungesehen. In einer Zeit, in der man sich auf nichts mehr verlassen kann, wie es scheint. Deshalb ist „Nein“ in meinen Augen kein ganzer Satz. Wir müssen im Gespräch bleiben, auch wenn es erschöpft, wenn wir uneins sind, genervt oder sogar ernstlich voneinander angekotzt.
Ein „Nein“ hat eine Begründung verdient! „Nein ist ein ganzer Satz“ meint, ich habe es nicht nötig, mich zu rechtfertigen. Aber eine Erklärung ist keine Rechtfertigung. Sie trägt zur Verständigung bei, ist menschlich und empathisch, selbst wenn sie gebrüllt wird. Zur Rechtfertigung wird sie erst, wenn wir sie selbst so bewerten – aus Schuldgefühlen heraus oder weil wir Angst vor der Reaktion auf unser „Nein“ haben. Angst anzuecken, als schwach oder nutzlos zu gelten, Angst angegriffen oder fallen gelassen zu werden. Sagen wir einfach nur „nein“, nehmen wir diese Gefühle vorweg, eliminieren werden wir sie dadurch nicht.
Das heißt nicht, dass wir in Beziehungen, Arbeitsverhältnissen und familiären Gemengelagen ausharren sollten, die uns nicht gut tun. Dass wir die Zähne zusammenbeißen und einfach immer weitermachen sollten. Im Gegenteil. Wenn etwas dauerhaft wehtut, verdient es eine Veränderung. Mit einem „Nein“ alleine, wird das aber nicht gelingen.
Eure Nachbarin

Okt. 15, 2022 | Uncategorized
„Urlaubsende“ hat meine Mutter immer in die alten Fotoalben mit den rotstichigen Bildern geschrieben. Unglaublich, dass man sich damals auf eineinhalb 36-Filme beschränkte, wenn man zwei Wochen unterwegs war. Nun naht auch bei uns das Ende unserer fantastischen Reise.
Der Malanser Nieselregen weitet sich auf unserer Tour in Richtung Neu-Ulm zu wahren Sturzbächen aus, die die ganze Nacht auf uns niederprasseln. Der Stellplatz erweist sich als einfache Parkbucht in einem Wohngebiet. Hätte hier nur ein Auto mehr gestanden, hätten wir weiterfahren müssen. So aber entspricht das Bild, das wir uns im Dunkeln durch den Regenschleier machen, genau dem Foto auf Park4night, als wäre es heute aufgenommen worden. Vielleicht hat es ein wohlmeinender Anwohner dort eingestellt, denke ich hoffnungsvoll, denn irgendwie fühle ich mich fehl am Platz. Und so schlafe ich wegen der nassen Dauerbeschallung von oben und aus innerer Sorge, dass ein Nachbar empört an die Türe klopfen könnte, etwas flach.
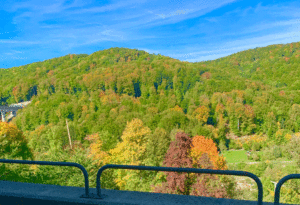 Niemand klopft an die Tür und der Regen lässt über Nacht immerhin so weit nach, dass ich am nächsten Morgen wieder etwas durch die Windschutzscheibe erkennen kann. Gut, dass nach wie vor mein Mann fährt. Wir passieren auf der Rückfahrt wieder das schönste Autobahnteilstück Deutschlands, den Albaufstieg, den wir dieses Mal hinabfahren. Auf der Hinfahrt standen wir hier bei strahlendem Sonnenschein im Stau und konnten die Umgebung in vollen Zügen genießen. Heute wabert der Nebel um uns herum und erlaubt keine spektakulären Ausblicke mehr. Wir kommen zügig voran und erreichen die Heimat um kurz vor 13 Uhr zufrieden und unversehrt. Knapp 2700 spektakuläre Kilometer liegen hinter uns.
Niemand klopft an die Tür und der Regen lässt über Nacht immerhin so weit nach, dass ich am nächsten Morgen wieder etwas durch die Windschutzscheibe erkennen kann. Gut, dass nach wie vor mein Mann fährt. Wir passieren auf der Rückfahrt wieder das schönste Autobahnteilstück Deutschlands, den Albaufstieg, den wir dieses Mal hinabfahren. Auf der Hinfahrt standen wir hier bei strahlendem Sonnenschein im Stau und konnten die Umgebung in vollen Zügen genießen. Heute wabert der Nebel um uns herum und erlaubt keine spektakulären Ausblicke mehr. Wir kommen zügig voran und erreichen die Heimat um kurz vor 13 Uhr zufrieden und unversehrt. Knapp 2700 spektakuläre Kilometer liegen hinter uns.
Wir haben unser Wohnmobil ins Herz geschlossen und diese Art des Reisens auch. Meine Wetter-Wünsche, die ich drei Wochen zuvor ans Universum geschickt habe, haben gefruchtet und uns den schönsten Oktober aller Zeiten beschert. Mittlerweile ist der Himmel auch wieder klarer und wir ziehen von unserem Wohnmobil wieder ins Haus. Dort türmen sich unangetastete Wäscheberge, während wir zuerst zu einem nahegelegenen Waschplatz für LKW fahren. Prioritäten müssen sein! Liebevoll waschen wir den Reisestaub von unserem Ahorn. Ich fühle mich dem Riesen so verbunden, dass ich ihm auch noch die Haare und die Nägel gemacht hätte… Aber der Abschied ist unausweichlich. Mit zwei weinenden Auge geben wir unser Möff am nächsten Tag an seinen Besitzer zurück.
Danke!! Es war wunderbar. Der Urlaub ist zu Ende und wir werden ihn nie vergessen.
Die Nachbarin


Okt. 13, 2022 | Auf Reisen, Uncategorized, Womo-Liebe
Bei der Recherche für unseren Urlaub hatte ich irgendwo mal gelesen, „die Schweizer mögen keine Wohnmobile“. Ach Quaaaaaatsch, habe ich mir da noch gedacht. Und auch jetzt kann ich ja nur von unserer einzelnen Erfahrung am Lago Maggiore berichten. Aber irgendwie kam da schon so ein kleines Gefühl auf. Wie gesagt, der Stellplatz hinter den sieben Bergen war grün, sauber und gut ausgestattet, wenn auch ohne eine Möglichkeit, dort jemals wegzukommen. Sicher hätten wir auf einem Campingplatz am See mehr Spaß gehabt. Aber zum einen ging es uns ja bloß um eine Nacht auf der Durchreise und zum zweiten wollten wir nur mal einen Blick auf den See erhaschen, ohne alles mit unserem großen Gefährt zu blockieren.



Okay, zugegebenermaßen konnten wir einen Blick erhaschen, bei einem kurzen Halt in zweiter Reihe. Voller Vorfreude hatten wir uns über die Zufahrtstraße dem See genähert, weil dort ein Parkplatz für Wohnmobile freigegeben sein sollte. Wenn dem mal so war, dann ist das nun vorbei. Heute hängen dort an der Einfahrt Höhenbeschränkungen, die nur noch für Autos passierbar sind. Wir hätten supergerne den leeren Platz genutzt, um für ein, zwei Stunden dort zu stehen, mit Blick auf den See zu frühstücken und ein bisschen am Ufer entlang zu spazieren. So aber reichte es nur für eine fünfminütige Stippvisite, bei der die Fotos entstanden sind. Gefrühstückt haben wir dann im Wareneingang eines größeren Einkaufszentrums, mit Blick auf ein paar vollgesprayte Mauern, während neben uns mit lautem Getöse eine Baumaschine verladen wurde…
Die Nachbarin – motiviert hier wegzukommen

Okt. 12, 2022 | Auf Reisen, Uncategorized, Womo-Liebe
Die Sonne strahlt mal wieder vom blauen Himmel, als wir unser liebgewonnenes Möff am nächsten Morgen ausgefertig machen. Die Straße ruft! Wir stöpseln den Landstrom ab, kontrollieren die Räder auf dem Träger, lassen mit einer gewissen Routine Grauwasser in die Kanalisation laufen und leeren mit Todesverachtung die Toilettenkassette. Tochter Hose verabschiedet sich unterdessen von jeder Katze im Umkreis. Als wir vom Platz rumpeln, entdecken wir begeistert ein Kunstwerk. Da haben Wohnmobilisten anscheinend jedes einzelne Reiseziel künstlerisch auf ihrer Karosserie verewigt und sie sind offensichtlich schon weit gereist. Ein Campingwagen als Leinwand. Tolle Idee! Wir kehren noch kurz an der Tanke ein – mit vollem Magen fährt unser Wagen einfach besser – und biegen dann auf die lange Straße ein, die Marina di Pisa mit der Autobahn verbindet.

Über den Highway geht es viereinhalb Stunden durch die Berge in Richtung Schweiz. Lange hatten wir in der Region um den Lago Maggiore nach einem Camping- oder Stellplatz für unser Wohnmobil gesucht und uns schließlich für Camper Area Tamaro entschieden. Das ist unser heutiges Ziel. Auf der Rückfahrt kämpfe ich mit einem fiesen Moskitostich, der von Parma über Mailand bis zum Comer See immer weiter anschwillt und ziemlich zwiebelt. Ziemlich unkonzentriert sorge ich dann leider auch dafür, dass wir die letzte italienische Tanke verpassen und in Teuerland nachladen müssen. Damit nicht genug, vergessen wir, dass mein Handy mit Töchterchens iPad verbunden ist und erhalten nach zehn Minuten durch die Schweiz die freundliche Info, dass mein Kontingent von 50 Euro nun aufgebraucht ist. Das ist mal eine kostspielige Begrüßung. Wenigstens klebt bereits eine gültige Jahresvignette von einem Vormieter an der Windschutzscheibe, so dass wir wenigstens die 42 Euros dafür sparen.

Ein bisschen fluchend passieren wir Tunnel und Pässe und schrauben uns in der Höhe um den Comer See herum, auf den ich über die hohe Leitplanke hinweg einen kurzen aber atemberaubenden Blick erhasche. Dann tauchen wir auch schon in die Dunkelheit des nächsten Tunnels ein. Die Straße ist voll und so nähern wir uns nur langsam dem Lago Maggiore mit dem, wie soll es anders sein, ich eine wunderschöne Kindheitserinnerung verbinde. Bei einer Chorfahrt mit der Schule, die uns ins oberitalienische Novara führte, hatten wir hier die Isola Bella besucht und diesen Traum von einer Insel habe ich nie vergessen. So wirklich romantisch wirkt unsere heutige Strecke nicht uns so beschließen wir, müde wie wir sind, zuerst einmal zu unserem Stellplatz zu fahren und von dort die Aussicht über den See zu genießen. Wenn es denn eine gegeben hätte.

Als wir nach endlosen Serpentinen endlich den Stellplatz erreichen, der gleich neben der vielbefahrenen Straße liegt, kommen uns zwei Camper entgegen. „Stehen kann man hier gut, aber sonst gibt es echt nix zu sehen“, meinen sie enttäuscht. Und tatsächlich sind wir hier im absoluten Hinterland gestrandet. Keine Frage, der Platz ist schön grün und schweizerisch sauber. Hohe Bäume erinnern an einen Rotkäppchenwald, aber die einzige Aussicht, die wir hier haben, ist die auf die Tankstelle gegenüber. Ein paar Versuche zu Fuß noch etwas Sehenswertes zu erreichen und ein hoffnungsvoller Blick auf den Fahrplan der Bushaltestelle direkt vor dem Platz offenbart: Das war es für heute. Also ziehen wir uns in unser Domizil zurück und beenden den Tag in Ruhe.
Die Nachbarin – müde und ein bisserl angedätscht

Okt. 11, 2022 | Auf Reisen, Fahrrad-Liebe, Familie Hose, Schönheiten, Uncategorized, Womo-Liebe
Mittagsschlaf stärkt und so zieht es uns am späten Tag nochmal ans Meer. Wenn wir unser Wohnmobil pünktlich wieder zurückbringen wollen, müssen wir morgen los. Es ist also unser letzter Abend hier in Marina di Pisa. Wir schnallen die Kinnriemen unserer Fahrradhelme fest und düsen, nach einer ausgiebigen Streichelrunde unter diversen Katzen am Rande des Stellplatzes, über den Trammino in Richtung Abendrot. Und das hat es heute wirklich in sich. Ganze Armadas von Engeln müssen hier irgendwo Plätzchen backen.


Wir stellen unsere Räder an der verwaisten Promenade ab, suchen uns eines der menschenleeren Bagnos aus und toben im Sand und im knietiefen Wasser herum. Die Horizontlinie entzieht sich wegen eines aufgeschütteten Steinwalls unseren Blicken, dafür liegt das Wasserbecken abgeschirmt von der Brandung da wie ein Spiegel. Gleich oberhalb unseres Strandabschnitts steht ein einzelnes Wohnmobil, das auch gestern schon dort parkte. In der ersten Reihe, mit dem grandiosesten Meerblick aller Zeiten. Es scheint niemanden zu stören. Drin sitzen Vater und Sohn und es sieht einfach nur gemütlich aus. Abschied hängt in der Luft und Dankbarkeit für unseren Urlaub, die vielen Eindrücke, die harmonische Dreisamkeit, unser treues Gefährt und diesen letzten schönen Abend am Meer. Jetzt kann es nach Hause gehen.

Die Nachbarin – dankbar




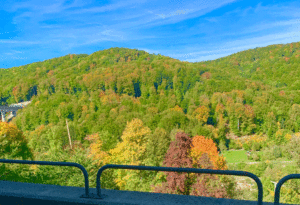 Niemand klopft an die Tür und der Regen lässt über Nacht immerhin so weit nach, dass ich am nächsten Morgen wieder etwas durch die Windschutzscheibe erkennen kann. Gut, dass nach wie vor mein Mann fährt. Wir passieren auf der Rückfahrt wieder das schönste Autobahnteilstück Deutschlands, den Albaufstieg, den wir dieses Mal hinabfahren. Auf der Hinfahrt standen wir hier bei strahlendem Sonnenschein im Stau und konnten die Umgebung in vollen Zügen genießen. Heute wabert der Nebel um uns herum und erlaubt keine spektakulären Ausblicke mehr. Wir kommen zügig voran und erreichen die Heimat um kurz vor 13 Uhr zufrieden und unversehrt. Knapp 2700 spektakuläre Kilometer liegen hinter uns.
Niemand klopft an die Tür und der Regen lässt über Nacht immerhin so weit nach, dass ich am nächsten Morgen wieder etwas durch die Windschutzscheibe erkennen kann. Gut, dass nach wie vor mein Mann fährt. Wir passieren auf der Rückfahrt wieder das schönste Autobahnteilstück Deutschlands, den Albaufstieg, den wir dieses Mal hinabfahren. Auf der Hinfahrt standen wir hier bei strahlendem Sonnenschein im Stau und konnten die Umgebung in vollen Zügen genießen. Heute wabert der Nebel um uns herum und erlaubt keine spektakulären Ausblicke mehr. Wir kommen zügig voran und erreichen die Heimat um kurz vor 13 Uhr zufrieden und unversehrt. Knapp 2700 spektakuläre Kilometer liegen hinter uns.












Neueste Kommentare